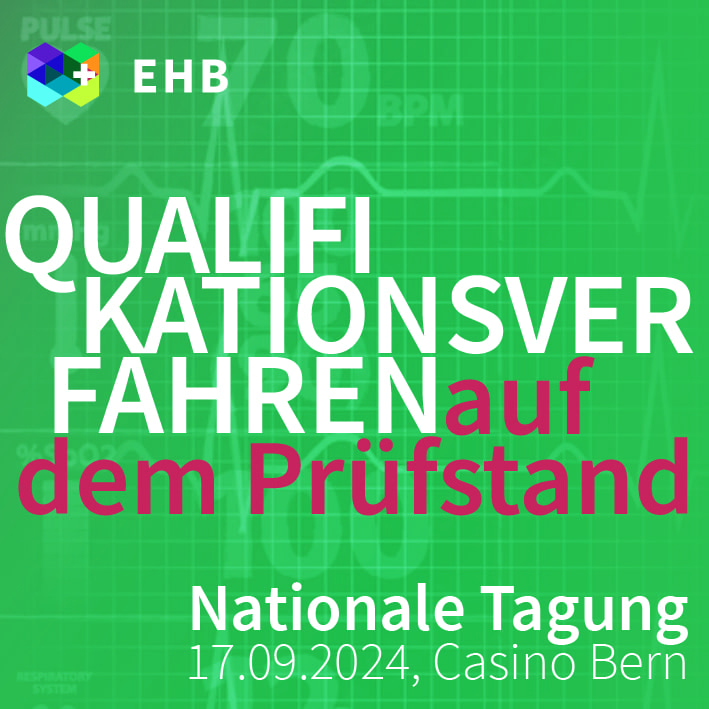Gemeinsam mit der PH Zürich führt die SGAB eine Tagung zum Thema „Automatisierung, KI und Learning Analytics in der Berufsbildung – Chancen und Risiken“ am 23. Mai 2023 durch (Agenda und Flyer). Referate sowie individuell wählbare Workshops aus der Praxis und der Wissenschaft geben Ihnen einen Einblick rund ums Tagungsthema. Ein Apéro zum Abschluss wird […]
Suchergebnisse für Forschung
Gemeinsam mit dem SVEB sowie den SwissSkills führte die SGAB eine Tagung zum Thema „Lebenslanges Lernen im Kontext der Berufsbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick rund ums Thema „Lebenslanges Lernen im Kontext der Berufsbildung“. Alle Unterlagen der Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an […]
Gemeinsam mit der EHB führte die SGAB eine Online-Tagung zum Thema „Aufsicht und Begleitung während der betrieblichen Berufsausbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Aufsicht und Begleitung während der betrieblichen Berufsausbildung“. Alle Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an […]
Gemeinsam mit der SDK CSD führte die SGAB eine Online-Tagung zum Thema „Flexibilisierung der Berufsbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Flexibilisierung der Berufsbildung“. Alle wesentlichen Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an die Referent*innen für die spannenden Keynotes […]
Gemeinsam mit dem EHB führte die SGAB die Online-Tagung „Berufsfelddidaktik in der Schweiz“ durch. Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops (vgl. weiter unten) gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Berufsfelddidaktik in der Schweiz“. Alle wesentlichen Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an Prof. Antje Barabasch für die […]
Neuste Beiträge aus Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis
Viele Hürden – viele Chancen
Der Weg über die berufliche Grundbildung an die Pädagogische Hochschule gewinnt bildungspolitisch an Bedeutung – nicht zuletzt aufgrund des Lehrpersonenmangels in der Volksschule. Gleichzeitig ist aber noch wenig Wissen dazu vorhanden. Wieviele Absolvierende einer beruflichen Grundbildung gehen diesen Weg? Welche Wege stehen offen, welche Hürden sind zu bewältigen und welche Faktoren unterstützen diese berufliche Weiterqualifizierung? Die Ergebnisse des vorliegenden Beitrags zeigen, dass von den Absolvierenden der Sekundarstufe II, die ein Studium in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung aufnehmen, rund ein Sechstel über den Weg der beruflichen Grundbildung kommt. Die Analysen quantitativer und qualitativer Daten belegen jedoch auch, dass die angebotenen Zugangswege komplex und unübersichtlich sind. Zudem erschweren oder begünstigen Faktoren wie das Geschlecht, die absolvierte berufliche Grundbildung und die damit verbundene schulische Orientierung sowie die Durchlässigkeit zwischen den Ausbildungsbereichen den Übertritt ins Lehramt.
Die «Erstprüfung» elektrischer Installationen ist eine zentrale Handlungskompetenz von Elektrofachpersonen. Aber die Vermittlung dieser Handlungskompetenz stellt die Lernorte vor erhebliche Herausforderungen, was auch die ernüchternden Resultate in den Qualifikationsverfahren zeigen. Ein interdisziplinäres Innovationsprojekt der PH Zürich und der ZHAW nimmt sich dieser Problematik an und erprobt das Potenzial von Virtual Reality (VR) für den Aufbau beruflicher Handlungskompetenzen am Beispiel der Erstprüfung. Im Projekt wurde der Prototyp einer VR-Lernumgebung für Berufslernende der Elektrobranche entwickelt und dessen Wirkung in einer Feldstudie evaluiert. Die Resultate wiesen auf das Potenzial dieser Technologie für das berufliche Lernen hin.
Vor bald zwanzig Jahren trat das aktuell gültige Berufsbildungsgesetz in Kraft. Es löste eine grosse Zahl Innovationen aus, die im Bereich der Bildungspläne und Verordnungen mit einer pragmatischen Versuch-und-Irrtum-Strategie angepeilt wurden. So umfassend diese Innovationen waren, so auffällig ist es, dass bis heute keine fundierten theoretischen und empirischen Evaluationen zur Entwicklung, zur Implementation und zu den Resultaten von Verordnungen und Bildungsplänen durchgeführt worden sind. Das Paradigma der Handlungskompetenzorientierung als strukturgebendes Prinzip der Bildungserlasse konnte sich durchsetzen, ohne dass dazu eine umfassende Auseinandersetzung stattgefunden hätte. Die Folgen sind u.a. eine Marginalisierung des strukturierten Wissens in Form der traditionellen Fächer, die Dominanz der extremen Lernzielorientierung und, generell, der Durchbruch einer ökonomischen Logik und Kontrolllogik in der schweizerischen Berufsbildung. Eine kritische Bilanz mit einer konstruktiven Debatte ist für die Zukunft der Berufsbildung wünschenswert.
Wie Berufsverbände Berufe vermitteln
Viele Organisationen der Arbeitswelt präsentieren ihre Berufe auf der Suche nach Lernenden in Videos. Dabei wird durch die gewählten Inhalte und die Art der Vermittlung das Berufsbild mitkonstruiert und ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben. Berufsverbände haben ein Interesse daran, ihre Berufe und damit sich selbst am Leben zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickeln sie Strategien, die es ihnen erlauben, die Berufs- und Arbeitswelten aktiv mitzugestalten. Die vorliegende Analyse fokussiert diese Vermittlungsstrategien und welche Berufsbilder sie transportieren.
Zweisprachiger Unterricht an Berufsschulen
In der Schweiz boomt der zweisprachige Unterricht, vor allem auf der Sekundarstufe II. Gemäss einem neu erstellten Inventar des Instituts für Mehrsprachigkeit und der Universität Genf existieren landesweit 373 bilinguale Lehrgänge, rund Hälfte davon in den Gymnasien. In der beruflichen Bildung (Lehre und Berufsmaturität) werden rund hundert Lehrgänge gezählt; sie unterscheiden sich in Dauer und Ausgestaltung stark. Insgesamt verlieren die Landessprachen zugunsten des Englischen an Boden. In der Berufsbildung der einsprachig deutschen Schweiz wird in keinem einzigen Bildungsgang Französisch als Partnersprache angeboten – aus Sicht des Autors der Studie ein Befund, der diskutiert werden sollte.
Der Besuch eines Bildungsangebots hat positive Auswirkungen auf den Erwerb der Bildungssprache von Kleinkindern. Um in den täglichen Begegnungen und Aktivitäten reichhaltige und kindgerechte Interaktionen zu schaffen, bedarf es aber einer stärkeren Professionalisierung des gesamten pädagogischen Personals. Dies empfiehlt eine im Auftrag des SBFI erstellte Studie. Sie zeigt zudem, dass die frühe Sprachförderung von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich ist: Während einige Kantone und Gemeinden eine Reihe von Programmen und Strukturen eingeführt haben, diskutieren viele andere über geeignete Ansätze und Pilotprojekte.
Übergangssystem stösst an Grenzen
Junge Menschen, denen «Mehrfachproblematiken» attestiert werden, haben oft keine eigenen Ressourcen oder informelle Hilfen aus dem sozialen Umfeld zur Bewältigung ihrer Probleme. Gleichzeitig sind auch die Berufsbildung und die Angebote des Übergangssystems häufig überfordert, wenn es um bedarfsorientierte Unterstützung geht. Dies zeigt eine Studie im Auftrag der Nationalen Plattform gegen Armut. Zu unübersichtlich ist die Struktur der verschiedenen Akteure, zu oft zielen diese Systeme auf eine einseitige Zielsetzung wie die Berufsintegration, auf der Strecke bleibt die soziale Integration. Die Studie macht deutlich, dass zur Umsetzung der Grundsätze einer «bedarfsorientierten Unterstützung» und «Koordination von Hilfen» Entwicklungen auf mindestens drei Systemebenen nötig sind: der strategischen Ebene, der Ebene der Fallführung und der Ebene der Fallbegleitung. Das Genfer Modellprojekt «Cité des Métiers» zeigt mögliche Ansatzpunkte.
Nach der obligatorischen Schulzeit gehen die Jugendlichen beruflich und schulisch unterschiedliche Wege. Zwei Drittel beginnen mit einer betrieblich organisierten Grundbildung, ein knappes Drittel tritt in eine Mittelschule ein und eine Minderheit von etwa sieben Prozent absolviert eine schulisch organisierte Berufsausbildung. Die Ergebnisse einer Längsschnittstudie zeigen, dass sich die informellen Kompetenzen Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition zwischen Jugendlichen in diesen drei Ausbildungstypen bis zum Alter von 21 Jahren unterschiedlich entwickeln. Der Grund dürfte in den verschiedenen Lern- und Sozialisationsumgebungen liegen, die in der betrieblichen Grundbildung am förderlichsten sind, um die oben genannten arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen herauszubilden. Der betrieblichen Berufsbildung kommt demnach eine wichtige Bedeutung zu, um die Leistungsmotivation von Jugendlichen zu stärken.
Eine Berufsausbildung ist nicht nur ein wichtiger Schritt ins Berufsleben; sie bietet auch die Möglichkeit, psychisch bedingte Arbeitsprobleme früh zu erkennen. Solche Arbeitsprobleme nehmen bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen stetig zu: Invalidisierungen aus psychischen Gründen haben sich bei den Unter-30-Jährigen in der Schweiz seit 1997 verdreifacht. Eine 2021 durchgeführte Befragung von Berufsbildenden liefert nun erstmals umfassende Daten, wie sie psychisch auffällige Lernende wahrnehmen, wie sie handeln und wie sicher sie sich dabei fühlen und wie häufig solche Probleme sind. Die Tatsache, dass rund 6‘400 Berufsbildende an der Befragung teilgenommen haben, weist auf deren Engagement und auf die Dringlichkeit der Problematik hin. Die Resultate zeigen, welche Merkmale zur Problemlösung beitragen und welche Risikofaktoren zu beachten sind. Die Studie macht auch konkrete Empfehlungen, wie Berufsbildende ihrerseits besser unterstützt werden können.
Der aktuelle Stand der Digitalisierung in der beruflichen Grundbildung ist bis heute weitgehend unbekannt. Die Daten der Standardisierten Abschlussklassenbefragung 2022 geben erste Anhaltspunkte aus Perspektive der Schulabgängerinnen und -abgänger von Deutschschweizer Berufsfachschulen. Auffallend dabei ist die durchwegs positive Beurteilung der schulischen Rahmenbedingungen, der digitalen Kompetenzen der Lehrpersonen und des Einsatzes digitaler Medien zu vielfältigen Zwecken im Unterricht. Der persönliche Lernzuwachs – insbesondere in unterrichtsfernen Bereichen – wird im Gegensatz dazu etwas moderater eingeschätzt.
Bilder lösen unterschiedliche Assoziationen aus; ein Baum im Herbst lässt die einen an den Winter denken, während andere dankbar an den Sommer denken. In der Laufbahnberatung sind solche Bilder wichtig. Man kann sie nutzen, um Geschichten zu erzählen. Genau dies tut die Laufbahnberatung, wenn sie sich narrativer Methoden wie des Career Construction Interviews, der Entwicklungslinie oder des Ressourcenbildes bedient. Der vorliegende Beitrag arbeitet den theoretischen Hintergrund dieser Methoden auf und zeigt ein Beispiel eines konkreten Verfahrens. Seine Basis bildet ein Fachbuch, das im Dezember erscheinen wird.
Während ihrer Ausbildung sind Jugendliche mitunter mit Herausforderungen konfrontiert, die ohne Unterstützung schwer zu bewältigen sind. Um Lernende mit persönlichen, schulischen, pädagogischen, sozialen und gesundheitlichen Problemen besser begleiten und unterstützen zu können, hat der Kanton Waadt 2001 die Lernendenberatung eingeführt. In dessen Auftrag führte die EHB nun eine Studie durch, um ihre Tätigkeit und alltäglichen Herausforderungen zu beschreiben und zu evaluieren.
Unterschätzter Bildungsbereich
Der berufsorientierten Weiterbildung kommt in der Öffentlichkeit häufig weniger Aufmerksamkeit zu als der beruflichen Grundbildung und der Höheren Berufsbildung. Das ist erstaunlich, denn ihre grosse Bedeutung ist spätestens seit den 1970er-Jahren eigentlich unbestritten. Vor diesem Hintergrund ist die Umbenennung des Lehrstuhls für Berufsbildung an der Universität Zürich nur logisch: Neu heisst er «Lehrstuhl für Berufs- und Weiterbildung». Seine neue Inhaberin, Prof. Dr. Katrin Kraus, macht im vorliegenden Text eine Auslegeordnung zur beruflichen Weiterbildung, an die sich weiterführende Forschungsperspektiven anschliessen lassen. So fragt das aktuelle Projekt «Governance: Cohesion and Context (GoCC)», wie Menschen Weiterbildungsentscheidungen im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit treffen und welche Steuerungsbedürfnisse es im Zusammenhang mit neuen Ansätzen zur Kompetenzentwicklung von Seiten verschiedener Akteure gibt.
Blick in die Glaskugel
Um am Übergang zwischen Sekundarstufe I und II einzuschätzen, wie gut zukünftige Lernende zu einem bestimmten Beruf passen, werden häufig auch Testergebnisse des Stellwerk 9 herangezogen. Eine Studie der Pädagogischen Hochschule Luzern untersuchte anhand von acht Berufsfeldern mit 6’687 Lernenden, inwiefern diese Testergebnisse die Leistungen in der beruflichen Grundbildung vorhersagen. Es zeigten sich in allen untersuchten Berufsfeldern zahlreiche Zusammenhänge der Testergebnisse mit den Noten im allgemeinbildenden und berufskundlichen Unterricht – allerdings in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Damit kann Stellwerk 9 zwar zusätzliche Informationen zum Kompetenzprofil von Lernenden bieten. Die mittelmässige Vorhersagekraft und die grossen Unterschiede zwischen den Berufsfeldern sprechen aber dafür, die Testergebnisse im Berufswahlprozess nur differenziert und bedacht einzusetzen.
Wer schlecht lesen, schreiben oder rechnen kann, dem fehlen grundlegende Kompetenzen. So einfach das klingt, so schwierig ist es in der Beratungspraxis, entsprechende Lücken festzustellen und Fördermassnahmen zu empfehlen. Das macht das Forschungsprojekt «Triage» im Auftrag der EDK deutlich. Triage zeigt, dass die Zielgruppe ebenso heterogen wie die Akteurslandschaft ist, welche Betroffene fördert. Diese Akteure haben unterschiedliche Aufträge – Arbeitsmarktintegration, wirtschaftliche Unterstützung, gesellschaftliche Integration – und benötigen dafür eine Vielzahl von Instrumenten, um situationsabhängig das Kompetenzniveau der Betroffenen einzuschätzen. Die Studie schlägt sechs Massnahmen zur Verbesserung der Situation vor – darunter eine bessere Verankerung des Themas in der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.
Was macht die Qualität der beruflichen Grundbildung aus? Vier Jahre lang haben sich Forscherinnen und Forscher im Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Projekts mit dieser Frage befasst. Dabei wurde ein Instrument entwickelt, das sich aus 13 Dimensionen zusammensetzt; mit ihm können die Lernenden die Qualität ihrer Ausbildung bewerten. Dieser «Fragebogen zur Qualität der dualen Lehre» kann sowohl von Lehrkräften an Berufsfachschulen als auch von Berufsbildenden in Betrieben genutzt werden. Er ist über Internet leicht zugänglich und auf die jeweiligen Adressaten zugeschnitten. Vorerst gibt es ihn allerdings nur in französischer Sprache.
Die Integration von Technologien wird in der Bildung zunehmend zu einem Muss und ist durch die COVID-19-Pandemie noch dringlicher geworden. In der (dualen) Berufsbildung lautet die Frage, inwieweit wir das didaktische Potenzial von Technologien tatsächlich ausschöpfen, um Lehr- und Lernprozesse zu unterstützen. Dieser Beitrag bündelt die Ergebnisse eines über 16 Jahre laufenden Langzeitforschungsvorhabens und geht von der Annahme aus, dass dafür in erster Linie ein starkes pädagogisches Konzept und nicht unbedingt die neueste Spitzentechnologie benötigt wird. Auf dieser Grundlage wird der «Erfahrraum» als ein berufsbildungsspezifisches pädagogisches Modell für die Technologieintegration eingeführt, das darauf abzielt, lernortübergreifendes Lernen zu verbessern. Seine Wirksamkeit für das Lernen und die Konnektivität zwischen den Akteuren der Berufsbildung wird an einem Beispiel veranschaulicht. Abschliessend werden die Projektergebnisse mittels zweier zusammenfassender Begriffe erörtert: visuell basierte Reflexion und Kooperation.
Jugendliche, die in Heimen leben, sehen sich bei der beruflichen Integration vor spezifische Herausforderungen gestellt. So erhalten sie von ihren Eltern oder aus ihrem erweiterten sozialen Umfeld bei der Berufswahl und während der Ausbildung in den meisten Fällen nur wenig Unterstützung. Auffällig ist, dass viele Betroffene eher eine niederschwellige Berufslehre wählen – und von anspruchsvolleren, vielleicht schulischen Ausbildungen an Mittelschulen kaum die Rede ist. Dies zeigt eine kürzlich abgeschlossene Studie der ZHAW Soziale Arbeit.
Die meisten Eltern wünschen sich für ihre Kinder, dass diese «es später einmal gut haben sollen». Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist eine gute Ausbildung. Aber wie in anderen Ländern auch, ist der Bildungserfolg in der Schweiz nicht nur von den Fähigkeiten und Wünschen der Jugendlichen abhängig, sondern zum grossen Teil von familiären Ressourcen und den Strukturen des Bildungssystems. So schneiden Jugendliche aus finanziell eher schlecht gestellten Familien im Schweizerischen Bildungssystem tendenziell schlechter ab und haben grössere Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Trotzdem gelingt es einigen, erfolgreich zu sein. Weshalb ist das so? Und welche Ausbildungswege gelten als erstrebenswert? Gibt es Unterschiede zwischen Familien mit und ohne Migrationshintergrund? Diesen Fragen geht der vorliegende Artikel anhand einiger Ergebnisse des Forschungsprojekts PICE nach.
Die Ausbildung einer Person bestimmt wesentlich über ihren Arbeitsmarkterfolg. Für die Schweiz zeigen Studien, dass der Arbeitsmarkterfolg von Personen mit einer Berufsbildung und von jenen mit einem allgemeinbildenden oder akademischen Abschluss vergleichbar ist. Um zu ermitteln, welcher dieser Ausbildungswege im Bewerbungsprozessen bevorzugt wird, befragten wir 2’384 Arbeitgebende in der Schweiz nach ihren Präferenzen im Bewerbungsprozess. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Arbeitgebende für Einstiegspositionen Bewerberinnen und Bewerber mit einer Berufslehre gegenüber denjenigen mit einer gymnasialen Maturität bevorzugen. Für höhere Positionen hängt diese Präferenz von der in der Stellenausschreibung erwähnten Position ab: Für die Verkaufsleitung werden Personen mit einer Höheren Berufsbildung bevorzugt, für die IT-Leitung sind es jene mit einem akademischen Abschluss. Zudem haben Arbeitgebende, die vertrauter sind mit der Berufsbildung, häufig eine stärkere Präferenz für diese Abschlüsse.
Der Verbleib in den Ausbildungen der beruflichen Grundbildung ist in der Schweiz alles andere als sicher. Jedes Jahr werden zwischen 20 und 25 Prozent der Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst, was den Werdegang der betroffenen Jugendlichen gefährdet. Die vorliegende Studie analysiert, inwiefern das Erleben oder Antizipieren von sexistischer und/oder homophober Diskriminierung durch Lernende dazu führen kann, dass sie ihre Berufsbildung abbrechen wollen. Die Ergebnisse zeigen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Erleben von homophober Diskriminierung und der Absicht, die Ausbildung abzubrechen.
Obwohl Berufsbildnerinnen und Berufsbildner im dualen Berufsbildungssystem eine zentrale Rolle einnehmen, wurde diese bisher in nur wenigen Studien untersucht. Um diese Lücke zu schliessen, befasst sich die vorliegende Doktorarbeit mit der Frage, wie Berufsbildende ihre Funktion wahrnehmen. Sie nimmt eine Typologisierung von Berufsbildenden anhand zweier Analyseachsen vor – der Zufriedenheit mit ihrer Funktion und der Wahrnehmung der Lernenden als Lernende respektive Arbeitskräfte. Daraus ergeben sich vier idealtypische Profile: die Selbstunternehmerinnen, die Garanten des Berufs, die Nostalgikerinnen und die Umsteiger. Diese Unterscheidung ermöglicht es, zu erfassen, welchen Stellenwert Berufsbildende der Ausbildung von jungen Lernenden einräumen. Zudem lassen sich Empfehlungen für Akteure ableiten, die an der dualen Ausbildung beteiligt sind.
Die Berufsmaturität (BM) ist Hauptzubringerin für die Fachhochschulen (FH). 2012 wurde der Rahmenlehrplan für die BM revidiert. Nun zeigt eine aktuelle Studie, wie es um die Studierfähigkeit der BM-Absolventinnen und -Absolventen steht und wie die BM künftig weiterentwickelt werden kann. Basierend auf Befragungen bei der FH-Studierendenkohorte 2019 sowie den FH-Bachelor-Studiengangleitenden zeigt die Studie zum einen auf, welche Faktoren der Vorbildung für die Bewältigung des Studiums bedeutend sind. Dabei offenbart die Evaluation Unterschiede zwischen den Fachbereichen. Zum anderen identifiziert sie insbesondere im Grundlagenbereich Optimierungspotenziale. Wie die Politik damit umgeht, zeigt ein Interview mit EBMK-Präsident Christof Spöring (ganz unten).
Eine gelingende Lernortkooperation gilt als eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe Ausbildungsqualität. Im Zuge der digitalen Transformation verändert sie sich aber. Das vom SBFI-geförderte Projekt «Zukunftsmodelle der Lernortkooperation» hat die Potenziale der fortgeschrittenen Digitalisierung (Data Analytics und Künstliche Intelligenz (KI)) für die Lernortkooperation untersucht. In einer ersten Phase wurden Erfolgsfaktoren sowie Good Practices für eine gelingende Lernortkooperation ermittelt. Die Hauptergebnisse werden in diesem Beitrag skizziert.
Immer mehr Jugendliche absolvieren eine Allgemeinbildung, während der Anteil der Lernenden in einer beruflichen Grundbildung schwindet. Weibliche Lernende und solche aus der Romandie zieht es besonders stark in Richtung Gymnasien oder Fachmittelschulen. Das zeigen erste Ergebnisse der längsschnittlichen Befragung der zweiten TREE-Kohorte, welche 2016 aus der Schulpflicht entlassen wurde. Im Vergleich zur ersten TREE-Kohorte von 2000 bleibt die Bedeutung der sozialen Herkunft und des auf Sekundarstufe I besuchten Schultyps für die weitere Bildungslaufbahn hoch. Trotz veränderter Lehrstellenmarktbedingungen landet ausserdem immer noch mehr als ein Fünftel der Jugendlichen zunächst in einer Zwischenlösung.
Viele Jugendliche engagieren sich freiwillig in Sportvereinen, in ihrer eigenen Familie oder auch in der Kirche. Ein von der Internationalen Bodenseehochschule gefördertes Projekt zeigt, dass dies für rund 62 Prozent der Jugendlichen zutrifft. Dieses Engagement eröffnet Berufsbildungsverantwortlichen die Möglichkeit, Bezüge zwischen den im Kontext der Freiwilligenarbeit gesammelten Erfahrungen und der beruflichen Tätigkeit bewusst zu eruieren und zu fördern. Ein Ziel könnte es sein, dass Lernende in die Lage versetzt werden, sich bewusst für ein Engagement zu entscheiden.
Es fällt nicht allen Jugendlichen leicht, die Berufslehre zu durchlaufen. Schulische und betriebliche Probleme, aber auch gesundheitliche oder familiäre Schwierigkeiten sorgen dafür, dass sie auf Beratung angewiesen sind. Mit «kabel» existiert im Kanton Zürich seit über 30 Jahren eine Fachstelle, die sich dieser Jugendlichen annimmt. Im Rahmen eines Projektes wurde das Angebot auf vier Berufsfachschulen erweitert. Eine Evaluation verdeutlicht den Beratungsedarf von Lernenden im ersten und zweiten Lehrjahr und zeigt eine hohe Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer. Das wirft die Frage auf, ob Angebote wie diese nicht an sämtlichen Berufsfachschulen sinnvoll wären.
Die Anstrengungsbereitschaft von Lernenden beim Eintritt in die Sekundarstufe II ist eine wichtige Voraussetzung für den Ausbildungserfolg. Erstaunlicherweise gibt es aber kaum Studien zur Frage, wovon die Anstrengungsbereitschaft im Lehrbetrieb, in der Berufsfachschule und in der allgemeinbildenden nachobligatorischen Schule abhängt. Neue Ergebnisse aus dem WiSel-Projekt zeigen, dass eine hohe Selbstwirksamkeit vor dem Übergang und eine gute Beziehung zu den Lehrpersonen und Berufsbildenden die Anstrengungsbereitschaft nach Eintritt in die Sekundarstufe II begünstigen.
Der Fachkräftemangel in vielen Handwerksberufen ist hoch, auch im Maurerhandwerk. Vielen Betrieben gelingt es immer weniger gut, Lernende zu finden und zu halten. Die Anzahl der lernenden Maurer (EFZ) ist zwischen 2015 und 2020 um ein Viertel zurückgegangen (BFS 2021). Körperliche Arbeit draussen, auch unter schlechten Wetterbedingungen, erscheinen Jugendlichen vielleicht wenig attraktiv. Eine qualitative Studie an der EHB mit angehenden Maurerinnen und Maurern zeigt, dass die Lernenden im Beruf Erfüllung finden und schnell lernen, mit den anfangs manchmal anspruchsvollen Arbeitsbedingungen klar zu kommen. Was manche jedoch schwierig finden sind die betrieblichen Ausbildungsbedingungen. Diese hängen nicht nur vom Lehrbetrieb ab, sondern haben auch branchenspezifische Gründe.
In der Schweiz beträgt der Anteil an Frauen in technischen oder mathematischen Studiengängen 22%; in Marokko aber 45%. Der Grund für diese Differenz erscheint paradox: Je reicher und egalitärer ein Land ist, desto weniger arbeiten die Frauen in technischen Berufen. Die Wissenschaft nennt das das «Gender Equality Paradox». Ein Forschungsprojekt erklärt die Ursache des Phänomens: Mit wachsendem Wohlstand nimmt der Zusatznutzen des Einkommens ab, gleichzeitig aber wachsen für Frauen die Identitätskosten in MINT-Fächern. Darum entscheiden sich viele Frauen gegen ein MINT-Studium. Die Studienautorinnen schlagen Wege vor, die aus dem Paradox führen könnten.
In Anwendungsfeldern wie der Personalauswahl oder der Berufs- und Laufbahnberatung spielt die Passung zwischen Person und beruflicher Umwelt eine zentrale Rolle. Dabei geht es unter anderem darum, wie gut die Persönlichkeit einer Person zum Beruf, Job oder Unternehmen passt. Eine hohe Passung ist wünschenswert, da sie sich positiv auf die Zufriedenheit und die berufliche Leistung auswirken sollte. In zahlreichen Studien wurde der Einfluss der Persönlichkeit auf die berufliche Leistung untersucht. Eine kürzlich veröffentliche Meta-Analyse zeigt: In verschiedenen Berufsgruppen können unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften helfen, mit den Anforderungen erfolgreich umzugehen und eine gute Leistung zu zeigen. Die Erkenntnisse sind nicht nur für die Personalauswahl relevant, um die passendsten Bewerbenden zu identifizieren. Auch in der Berufs- und Laufbahnberatung kann das Persönlichkeitsprofil eine Grundlage für die Selbstreflektion und individuelle Weiterentwicklung bilden.
In der ökonomischen Theorie und Praxis besteht ein breiter Konsens, dass Bildung im Allgemeinen und tertiäre Bildung im Speziellen eine Grundvoraussetzung für Innovation darstellen. Da diese Diskussion jedoch stark angelsächsisch geprägt ist, blieb die Rolle der beruflich orientierten Tertiärbildung an Fachhochschulen (FHs), die angewandte Forschung betreiben und sich auf Studierende mit einer abgeschlossenen beruflichen Grundbildung fokussieren, bisher weitgehend unklar. Eine Reihe von Studien des «Swiss Leading House VPET-ECON», die die Gründung von FHs seit Mitte der 1990er-Jahre in der Schweiz untersucht, liefert nun erste Erkenntnisse, wie und unter welchen Voraussetzungen FHs in den Bereichen «Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik» (MINT) die regionalen Innovationsaktivitäten beeinflussen. Zusammengefasst zeigen sich zwei Dinge. Erstens wirkte sich die Gründung der FHs positiv auf die regionale Innovationsaktivität aus. Zweitens sind die positiven Innovationseffekte in Regionen mit einem grossen, einem dichten und einem high-tech-intensiven regionalen Arbeitsmarkt besonders stark. Aus diesen Erkenntnissen können konkrete Politikempfehlungen zur (räumlichen) Weiterentwicklung der FH-Landschaft Schweiz abgeleitet werden.
Bei der Recherche von Fachinformationen wird häufig auf Suchmaschinen wie Google und dessen Dienst Google Scholar zurückgegriffen. Diese umfassen zwar eine Vielzahl von Quellen und Dokumenten, führen aber nicht immer zu relevanten Treffern. Im vorliegenden Beitrag werden Möglichkeiten vorgestellt, wie mithilfe von bestimmten Operatoren und Befehlen die Suche spezifiziert werden kann. Zudem werden einschlägige Fachportale und Literaturdatenbanken zur Berufsbildung als Alternativen vorgestellt.
Die duale Berufsbildung ist eigentlich trial: Mit den überbetrieblichen Kursen steht Betrieben und der Berufsfachschulen ein dritter, ebenso wichtiger Lernort zur Seite. Eine Studie der Pädagogischen Hochschule leuchtet seine Aufgaben aus und beschreibt vier hauptsächliche pädagogische Funktionen: Einführung, Standardisierung, Anwendung, Reflexion. Aber wie geht man in den Kursen mit dem unterschiedlichen Kenntnisstand der Lernenden um? Wie kooperieren die drei Lernorte? Die Studie beantwortet diese Frage pragmatisch: Für die überbetriebliche Ausbildung sei schon viel gewonnen, wenn Bildungsinhalte auf Bundesebene zwischen den Lernorten gut abgestimmt sind, sich die üK noch stärker am jeweils individuellen Lernstand der Lernenden orientieren und sich die Lernorte effizient und wirkungsvoll über das Erreichte gegenseitig informieren, nicht zuletzt durch die Nutzung der zur Verfügung stehenden digitalen Technologien.
Lernende und Bildungsverantwortliche wissen, dass eine Lehre nicht immer frei ist von Problemen und Konflikten. So beanstanden manche Lernende die Betreuung im Betrieb, während Berufsbildungsverantwortliche zuweilen die Motivation der Lernenden bemängeln. Die kantonale Lehraufsicht ist für beide Seiten da. Eine Studie der EHB zeigt aber, dass diese äusserst heterogen organisiert ist. Das wirft die Frage nach der Gleichwertigkeit der Leistungen, der Qualität und der Professionalisierung auf.
Die Bereitschaft der Betriebe, Berufslernende auszubilden, unterscheidet sich in der Schweiz je nach Region. Besonders deutlich wird dies zwischen den Sprachregionen, wo die betriebliche Ausbildungsbeteiligung in der Deutschschweiz höher ist als in der Romandie. Dieser Unterschied lässt sich nicht mit unterschiedlichen finanziellen Anreizen erklären, die für die Ausbildungsentscheidung von Betrieben ansonsten eine wichtige Rolle spielen. In einem kürzlich publizierten Artikel (Aepli et al. 2021) stellen wir deshalb eine komplementäre Erklärung für die unterschiedliche Ausbildungsbeteiligung von Betrieben vor: kulturell geprägte Unterschiede in lokalen Normen.
Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) für lebenslanges Lernen gilt als eines der zentralen Umsetzungsinstrumente des Kopenhagen-Prozesses. Er sollte Bildungsabschlüsse allgemeiner und beruflicher Art grenzübergreifend vergleichbar machen und die Transparenz erhöhen. Eines der Ziele: Die Steigerung der internationalen Mobilität der Lernenden und Arbeitnehmenden. Tatsächlich aber bleibt eine Anwendung des vom EQR abgeleiteten schweizerischen Qualifikationsrahmens (NQR) auf dem Bildungs- bzw. Arbeitsmarkt weitestgehend aus. Dieses Versagen lässt sich über neoinstitutionalistische Mechanismen (Imitation, Zwang, Druck) erklären.
In der deutschen Schweiz absolvieren 64 Prozent der Jugendlichen eine Lehre. Ganz anders in der Romandie, wo dies nicht einmal die Hälfte des Jahrgangs tun. Ein vom Schweizerischen Nationalfonds finanziertes Forschungsprojekt ging der Frage nach, warum das so ist. Der Beitrag zeigt anhand von drei Kantonen (ZH, GE, TI), dass wichtige politische Weichenstellungen Anfang der 60er-Jahre erfolgten, unter anderem mit dem Vollzug des neuen Berufsbildungsgesetzes. Während man im Kanton Zürich die Initiative den Berufsverbänden überliess, die weitgehend an der Organisation der kantonalen Berufsbildung beteiligt waren, verstand man im Kanton Genf die Berufsbildung als Teil eines umfassenderen Bildungssystems mit politischen und sozialen Zielen.
Nicht erst seit den Covid-19-bedingten Schulschliessungen im Frühjahr 2020 verändert die Digitalisierung das Lernen, Lehren und Leben an den Schulen. Die Bedeutung digitaler Technologien für die Strukturierung und Organisation von Institutionen, Inhalten und Interaktionen im Bildungswesen wächst seit Jahren. Die Fachagentur Educa hat im Auftrag von Bund und Kantonen nun erstmals das aktuelle Wissen zum Stand und den Auswirkungen der Digitalisierung im Bildungswesen Schweiz zusammengefasst – von der Primarschule bis zur Sekundarstufe II.
Dank Beziehungen zur Lehrstelle
Die Rekrutierung von Lernenden ist für Betriebe keine leichte Aufgabe. Einige beschreiten dabei unkonventionelle Pfade und stellen Jugendliche ein, deren familiäres Umfeld sie kennen oder die aus dem gleichen Ort herkommen. Man kann diese Faktoren als «autochthones Kapital» bezeichnen. Die Betriebe geben damit Jugendlichen eine Chance, die unter normalen Umständen für die Lehrstelle eher nicht in Frage gekommen wären. Eine Studie der EHB zeigt, dass dieser Faktor bedeutender ist als man erwarten würde.
In aktuellen Diskussionen zur Berufsbildung wird oft argumentiert, dass Ausbildungscurricula der beruflichen Grundbildung möglichst allgemein gehalten werden sollten und «kleine» Ausbildungsberufe zu vermeiden seien, um eine möglichst gute Mobilität und Anpassungsfähigkeit der Lernenden am Arbeitsmarkt zu fördern. Dabei wird jedoch übersehen, dass die Arbeitsmarktfähigkeit eines Ausbildungsberufes nicht unbedingt vom Anteil allgemeiner schulischer Qualifikationen (wie Mathematik oder Sprachen) bestimmt wird oder von der (mangelnden) Grösse eines Berufes. Ausschlag gebender ist die Frage, wie sehr die Kompetenzbündel eines bestimmten Berufes mit denjenigen des restlichen Arbeitsmarktes übereinstimmen bzw. abweichen – und das muss weder vom Anteil schulischer Inhalte noch von der Grösse des Berufes abhängen. Vor diesem Hintergrund zeigen die vorliegenden, empirischen Studien, wie in der Praxis ein quantitatives Mass für die Spezifität von Berufen berechnet werden kann und wie dieses in Zusammenhang steht mit den Lohnentwicklungen, der Berufsmobilität und der Anpassungsfähigkeit von Absolventen mit eher generellen oder eher spezifischen Berufen.
Nicht immer passen die vorgeschriebenen Lerninhalte einer beruflichen Grundbildung perfekt zur Tätigkeit eines Lehrbetriebs. Dieses Passungsproblem kann zu zusätzlichen Kosten für die Lehrbetriebe führen, wie eine neue Studie der EHB zeigt. Diese Kosten wachsen, je breiter die Qualifikationsprofile sind. Umgekehrt sorgen breite Profile aber dafür, dass die Lernenden nach der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt für eine breite Palette von Stellen qualifiziert sind. Dieses Dilemma ist typisch für die Berufsbildung: Bei der Definition von Berufen und Berufsprofilen muss darum eine optimale Balance zwischen den Ansprüchen der Lernenden beziehungsweise späteren Fachkräfte einerseits und den Ansprüchen der Lehrbetriebe andererseits gefunden werden.
Wie bereiten Lehrpersonen den Unterricht am besten vor? Vor über zehn Jahren erschien ein Buch, das diese Frage mit einem Strukturmodell beantwortete: AVIVA. Seither hat das Modell in der Schweiz und anderen deutschsprachigen Ländern grosse Beachtung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen gefunden; es wurde zu einem Referenzpunkt in zahlreichen Grundlagenwerken und wissenschaftlichen Beiträgen zur Schulpädagogik. Die Autoren des vorliegenden Beitrags fassen nun erstmals ihre Überlegungen zum Einsatz von AVIVA in Blended Learning Arrangements zusammen.
Genf ist kein Vorzeigekanton in Sachen Berufsbildung. 2020 machten nur 30,9% der Jugendlichen, die einen Bildungsgang der Sekundarstufe II besuchten, eine Lehre (in einem Betrieb oder in einer Schule); im Schweizer Durchschnitt sind es 59,3%. Es gab eine Zeit, da war dies ganz anders: In den Jahren zwischen 1950 und 1970 war der Kanton Genf ein Vorreiter der beruflichen Bildung in der Schweiz. Diese Zeit wurde geprägt vom vielleicht bedeutendsten Pionier des Westschweizer Berufsbildungswesens: Raimond Uldry. Uldry hat als Leiter des Service des apprentissages (Amt für Lehrlingswesen) in den Jahren 1955-1976 ein sozial geprägtes Erbe hinterlassen, das heute noch interessant erscheint. Er verstand die Berufslehre als Ort der allgemeinen, kulturellen und der beruflichen Bildung zugleich; sie sollte jeder Person in jedem Alter möglich sein.