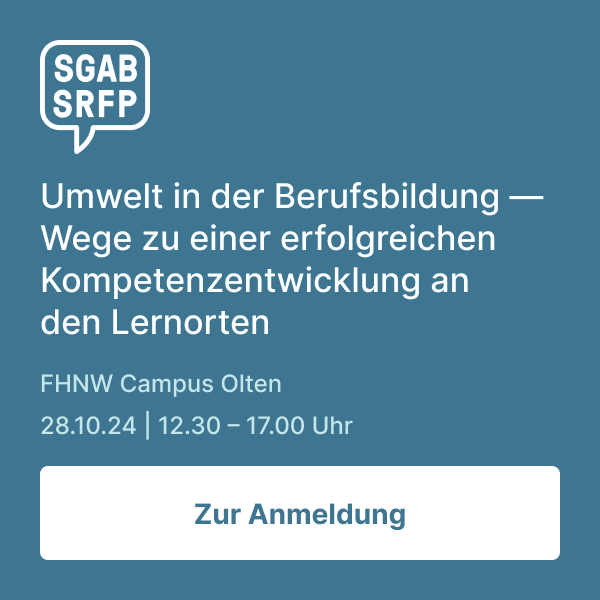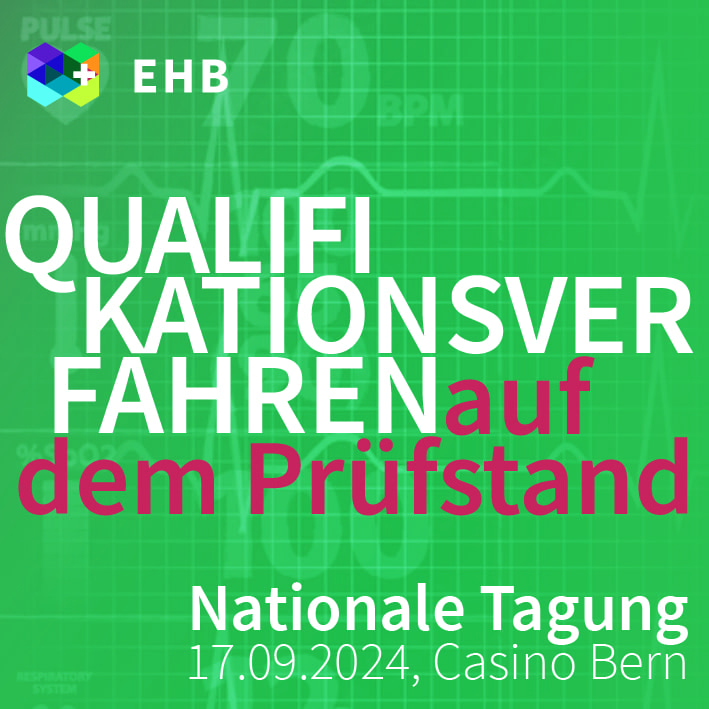Die Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung SGAB bildet eine Brücke zwischen der Berufsbildungsforschung und den Akteurinnen und Akteuren der Praxis. Hauptaktivitäten der SGAB sind die Publikation des online Magazins Transfer, die Durchführung von Tagungen sowie die Vergabe des Berufsbildungspreises. Die SGAB wurde 1987 gegründet und ist in allen Landesteilen der Schweiz aktiv (Jahresbericht).
Anmeldung und weitere Informationen zur Tagung.
Vorstand
Der Vorstand der SGAB setzt sich derzeit aus 24 Personen zusammen. Die Mitglieder der Gesellschaft stammen ebenfalls aus allen Sprachregionen und vertreten folgenden Bereiche: Lehrbetriebe, Berufsfachschulen, Berufsbildungsämter, Berufsberatungen, Berufsverbände, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände, Forschungsinstitute und Forschende an Hochschulen, in der Verwaltung und auf privater Basis.
Mitglied werden
Die SGAB steht allen Personen und Institutionen offen, die die schweizerische Berufsbildung mitgestalten und unterstützen wollen. Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie den Transfer zwischen der Forschung und der Praxis der Berufsbildung. Jetzt Mitglied werden.
Online Magazin Transfer abonnieren
Transfer publiziert jede Woche einen wissenschaftlichen oder journalistisch recherchierten Beitrag zur Berufsbildung. Abonniere Transfer kostenlos.
Tagungen
Zweimal im Jahr führt die SGAB gemeinsam mit einem Forschungs- oder Praxispartner eine Tagung zu Fragen rund um die Berufsbildung durch. Zur aktuellen Tagung. Wenn Sie eine Tagung verpasst haben, finden Sie alle Unterlagen im Archiv.
SGAB-Berufsbildungspreis
Gute Berufsbildungsforschung und deren Anwendung in der Praxis müssen anerkannt werden. Dafür gibt es unseren Berufsbildungspreis.
Inserieren im online Magazin Transfer
Das online Magazin Transfer ist ein interessanter Werbeträger mit einem klar definierten Zielpublikum. Über 5000 Personen haben den Newsletter Transfer abonniert. Mediadaten 2024 inkl. Kontakt für ein Inserat.
Kontakt Geschäftsstelle
Haben Sie Fragen rund um unsere Tätigkeiten? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme direkt über die Geschäftsstelle.