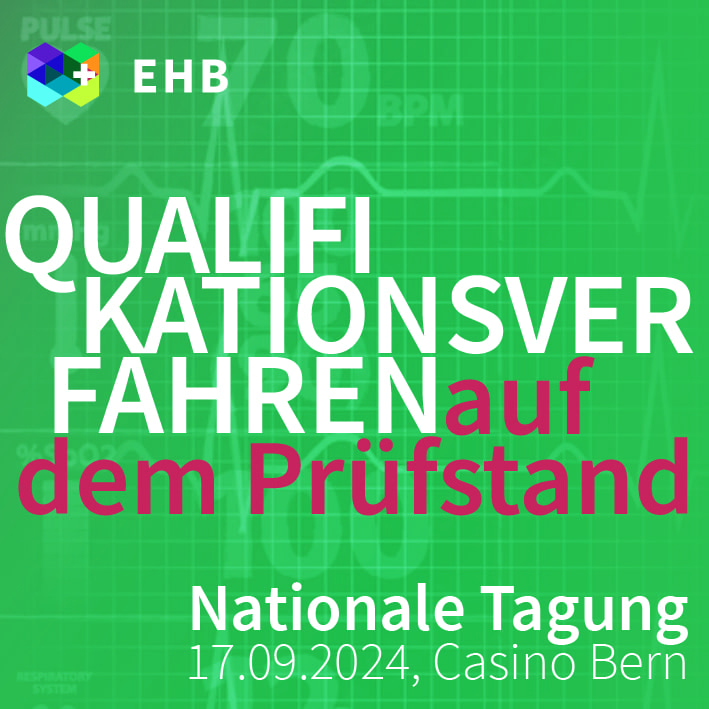Gemeinsam mit der PH Zürich führt die SGAB eine Tagung zum Thema „Automatisierung, KI und Learning Analytics in der Berufsbildung – Chancen und Risiken“ am 23. Mai 2023 durch (Agenda und Flyer). Referate sowie individuell wählbare Workshops aus der Praxis und der Wissenschaft geben Ihnen einen Einblick rund ums Tagungsthema. Ein Apéro zum Abschluss wird […]
Suchergebnisse für 1/2016
1-2016-de
Gemeinsam mit dem SVEB sowie den SwissSkills führte die SGAB eine Tagung zum Thema „Lebenslanges Lernen im Kontext der Berufsbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick rund ums Thema „Lebenslanges Lernen im Kontext der Berufsbildung“. Alle Unterlagen der Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an […]
Gemeinsam mit der EHB führte die SGAB eine Online-Tagung zum Thema „Aufsicht und Begleitung während der betrieblichen Berufsausbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Aufsicht und Begleitung während der betrieblichen Berufsausbildung“. Alle Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an […]
Gemeinsam mit der SDK CSD führte die SGAB eine Online-Tagung zum Thema „Flexibilisierung der Berufsbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Flexibilisierung der Berufsbildung“. Alle wesentlichen Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an die Referent*innen für die spannenden Keynotes […]
Gemeinsam mit dem EHB führte die SGAB die Online-Tagung „Berufsfelddidaktik in der Schweiz“ durch. Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops (vgl. weiter unten) gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Berufsfelddidaktik in der Schweiz“. Alle wesentlichen Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an Prof. Antje Barabasch für die […]
Neuste Beiträge aus Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis
Was nützt die Berufsbildungsforschung, wenn die Anliegen der Praxis nicht aufgenommen werden? Was nützen relevante Ergebnisse der Forschung, wenn sie nicht in der Berufsbildungspraxis ankommen? Berufsbildungsforschung darf kein Selbstzweck sein. Ihre Erkenntnisse sollten wenn immer möglich in die Praxis einfliessen und umgesetzt werden. Dazu müssen sie in eine verständliche Sprache übersetzt werden. – Ein Editorial der SGAB-Präsidentin, Nationalrätin Martina Munz.
Viele Berufe haben «ein Geschlecht». Eine Studie einer Gruppe von Forschenden zu diesem Thema hat den diesjährigen Coreched-Bildungspreis erhalten. Sie zeigt unter anderem, dass die Berufswahl von Frauen und Männern von familiären Zukunftsvorstellungen und antizipierten Erwartungen an die eigene familiäre Rolle beeinflusst wird. Wir publizieren die Laudatio von Irene Kriesi, EHB, anlässlich der Preisübergabe. Sie bettet die Studie in den Forschungskontext ein und fasst sie zusammen.
Die Diagnose von Kompetenzen ist anspruchsvoll. Sie umfasst Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen. Martin Keller, Institut für Wirtschaftspädagogik (IWP) der Universität St. Gallen, hat beobachtet, dass viele Bildungseinrichtungen Checklisten und Instrumente zur Kompetenzdiagnose verwenden, ohne grundlegende konzeptionelle Fragen geklärt zu haben. Das führt regelmässig zu Frustrationen. Keller skizziert in seinem Beitrag, den er anlässlich einer Fachtagung des Ostschweizer Kompetenzzentrums für Berufsbildung präsentierte, wie man es besser macht.
Die berufliche Grundbildung stellt, selbst wenn die Ausbildungen enge Qualifikationsprofile aufweisen, kein Risiko für die langfristige Beschäftigungsfähigkeit dar. Diese Erkenntnis ist das Ergebnis der Studie Beschäftigungs- und Lohnperspektiven nach einer Berufslehre der Universität Lausanne. Negativer stellen sich die Lohnperspektiven der Personen dar, die nur eine Berufslehre absolviert haben. Sie verdienen ab dem 30. Altersjahr schlechter als Personen, die nur eine gymnasiale Matura (und keine Tertiärausbildung) absolvierten. Der Lohnvorteil für die Maturität zeigt sich besonders stark bei Frauen.
Berufsbildung für Erwachsene ist in der Schweiz endlich zum wichtigen Thema geworden. Es ist nicht länger tolerierbar, dass über 500’000 Menschen über 25 ohne Abschluss auf Sekundarstufe II mehr schlecht als recht im Arbeitsmarkt stehen und gleichzeitig ein Mangel an Fachkräften besteht. Das neu erschienene Buch «Berufsabschluss für Erwachsene in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Blick nach vorn» zeigt auf, wie diese Situation verändert werden kann. Es macht Vorschläge zur Einrichtung eines beruflichen Grundbildungssystems für Erwachsene. Die SGAB führt zum gleichen Thema im November eine Tagung durch.
Formen des Problem-based Learning (pbl) halten in der Sekundarstufe II Einzug. Eine Tagung Mitte Juni erlaubte eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Konzept. Es zeigte sich, dass pbl-Ansätze eigentlich strategisch, zumindest aber curricular in den Lehrinstitutionen fest verankert und nicht zur Auflockerung der Lernenden eingesetzt werden sollten. Die Tagung förderte zudem durchaus Gemeinsamkeiten mit der konkurrierenden Lehrmethode zutage, der instruktionistischen Wissensvermittlung. Eine Tagungsphänographie.1
Das Prinzip der drei Lernorte bestimmt seit langem Organisation, Verantwortlichkeiten, Finanzierung der Berufsbildung. Die klassische Aufteilung lautet: Der Betrieb vermittelt die Praxis, die Schule die Theorie. Aber diese Aufteilung wird immer fragwürdiger. Theorie wird heute an allen drei Lernorten vermittelt, und auch am Erwerb überfachlicher Kompetenzen sind alle drei Lernorte beteiligt. Der Berufsbildungsfachmann Emil Wettstein plädiert für ein neues Strukturprinzip für die Berufsbildung – und einen Abschied vom Lernortsprinzip.
Das Prüfen von beruflichen Kompetenzen stellt Prüfungsexpertinnen und -experten vor neue Herausforderungen. Sie müssen Kriterien für ihre Beurteilungen und transparente Leistungsanforderungen formulieren. In der von rund 50 Personen besuchten SGAB-Tagung «Wie kompetenzorientiert prüfen Betrieb, Schule und Branche?» gingen Fachpersonen diesen neuen Anforderungen auf den Grund. Wir publizieren die Überlegungen von Katja Dannecker, EHB.
Die kaufmännische Grundbildung wurde in den vergangenen 30 Jahren dreimal reformiert. Eine inhaltliche Analyse des Instituts für Wirtschaftspädagogik der Bildungspläne zeigt, dass Themen, die der Wirtschaft nicht unmittelbar einen Nutzen stiften, zugunsten anderer Inhalte wie der Managementtheorie aufgegeben worden sind. Mühe macht weiterhin die curriculare Umsetzung der Förderung der überfachlichen Kompetenzen. Roland Hohl, Geschäftsleiter IGKG Schweiz, ergänzt die Zusammenfassung der Studie mit Überlegungen zu den nächsten Reformen.