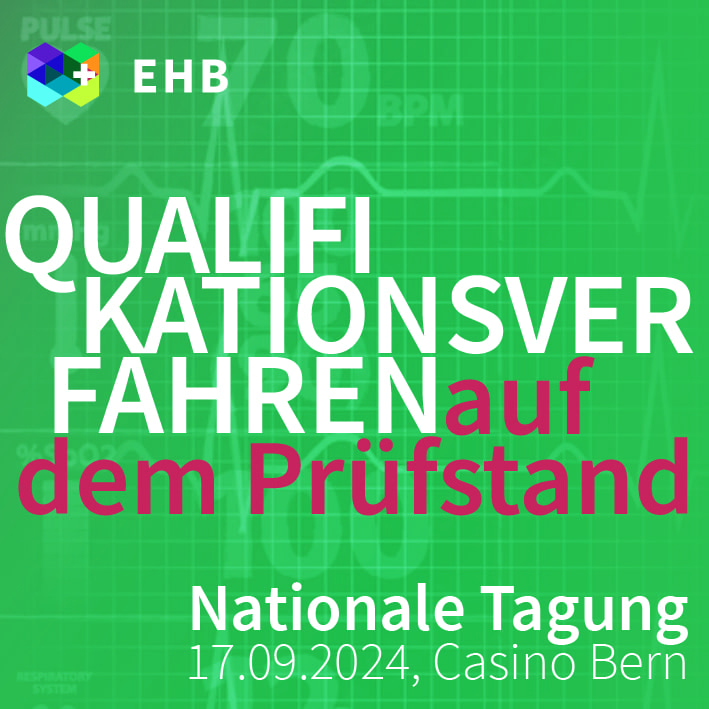Gemeinsam mit der PH Zürich führt die SGAB eine Tagung zum Thema „Automatisierung, KI und Learning Analytics in der Berufsbildung – Chancen und Risiken“ am 23. Mai 2023 durch (Agenda und Flyer). Referate sowie individuell wählbare Workshops aus der Praxis und der Wissenschaft geben Ihnen einen Einblick rund ums Tagungsthema. Ein Apéro zum Abschluss wird […]
Suchergebnisse für 1/2017
1-2017-de
Gemeinsam mit dem SVEB sowie den SwissSkills führte die SGAB eine Tagung zum Thema „Lebenslanges Lernen im Kontext der Berufsbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick rund ums Thema „Lebenslanges Lernen im Kontext der Berufsbildung“. Alle Unterlagen der Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an […]
Gemeinsam mit der EHB führte die SGAB eine Online-Tagung zum Thema „Aufsicht und Begleitung während der betrieblichen Berufsausbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Aufsicht und Begleitung während der betrieblichen Berufsausbildung“. Alle Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an […]
Gemeinsam mit der SDK CSD führte die SGAB eine Online-Tagung zum Thema „Flexibilisierung der Berufsbildung“ durch (Agenda). Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Flexibilisierung der Berufsbildung“. Alle wesentlichen Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an die Referent*innen für die spannenden Keynotes […]
Gemeinsam mit dem EHB führte die SGAB die Online-Tagung „Berufsfelddidaktik in der Schweiz“ durch. Referate aus der Praxis und der Wissenschaft sowie individuell wählbare Workshops (vgl. weiter unten) gaben Einblick zum aktuellen Stand der „Berufsfelddidaktik in der Schweiz“. Alle wesentlichen Unterlagen der Online-Tagung finden Sie weiter unten. Herzlichen Dank an Prof. Antje Barabasch für die […]
Neuste Beiträge aus Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis
Obwohl die betrieblichen Ausbilder und Ausbilderinnen eine zentrale Rolle im dualen Grundbildungssystem spielen, insbesondere bei der beruflichen Sozialisierung der Lernenden, wurde diese Funktion noch wenig untersucht. Eine Studie des EHB zeigt nun, dass die Ausbildenden mit zwei Herausforderungen konfrontiert sind. Erstens stehen sie in ihrer Doppelfunktion – als Ausbildende und Mitarbeitende – im Spannungsfeld zwischen Produktion und Ausbildung. Zweitens erweist sich die Anerkennung ihrer Arbeit als Ausbilder/in als zentral. Diese oft auf formeller Ebene fehlende Anerkennung läuft dann über die Rückmeldungen, aber auch über die Fortschritte der Lernenden.
Am 29. Oktober 2016 trafen sich rund 170 Fachpersonen zu einer Tagung der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik zum Berufseinstieg für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Die Tagung dokumentierte eine Vielzahl von Aktivitäten zur Verbesserung dieses oft schwierigen Übergangs. Erschwerend ist, dass der Arbeitsmarkt zu wenige Stellen für Menschen mit Einschränkungen bietet. Eines der Tagungsergebnisse: Die interinstitutionelle Zusammenarbeit sollte weiter professionalisiert werden.
Lehrpersonen, die berufskundlichen Unterricht erteilen, durchlaufen einen spannenden berufsbiografischen Weg: Sie entwickeln sich von Expertinnen in ihrem Fach zu Pädagogen. Dabei tritt ein Paradox auf, wie ein EHB-Forschungsprojekt zeigt. Ausbildung und pädagogische Praxis ermöglichen ihnen einerseits die Verbesserung ihrer Klassenführung; so gewinnen die Lehrpersonen Vertrauen in die eigene Fähigkeit zur Anregung der motivierten Beteiligung der Lernenden. Dieses Selbstvertrauen verführt sie andererseits dazu, die Wichtigkeit der Unterrichtsplanung geringer einschätzen. Statt pädagogischer Überlegungen rücken administrative Vorgaben in den Fokus.
Jedes Jahr erwerben rund 8000 Personen, die über 25 Jahre alt sind, ein Fähigkeitszeugnis. Das ist zu wenig, sind sich die Fachleute einig. Die grosse Mehrheit der Erwachsenen erreichen ihren Berufsabschluss zudem über eine reguläre oder verkürzte berufliche Grundbildung – beides Wege, die wenig flexibel, wenig erwachsenegerecht und relativ teuer sind. Verbesserungen zu erzielen ist allerdings anspruchsvoll und erfordert das Engagement aller Verbundpartner, wie eine gut besuchte, gemeinsame Tagung der SGAB und der Pädagogischen Hochschule Zürich deutlich machte. Wie es gehen könnte, zeigten einige Best Practices, zum Beispiel die modularisierten Ausbildungen am Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP) in Tramelan.
Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, dem besuchten Schultyp auf der Sekundarstufe I und dem nachobligatorischen Bildungserwerb ist hinreichend belegt. Eine Studie zeigt nun für die Schulabgangskohorte 2013, dass die Bildungsaspirationen von Jugendlichen durchaus auch in Zusammenhang mit regionalen Gelegenheitsstrukturen stehen. Ebenso beeinflussen diese auch den tatsächlich eingeschlagenen Bildungsweg auf der Sekundarstufe II.
Zwei von drei Schweizer Medaillengewinnerinnen und -gewinnern an Berufswettbewerben kommen aus Familien, in denen die Väter in einem Beruf arbeiten, die einer einfachen Qualifikationsebene zugeordnet wird. Und 56% haben die Sekundarschule nur auf einem mittleren oder gar tiefen Niveau abgeschlossen. Diese Erkenntnisse sind in einer Dokumentation von Margrit Stammzu finden. Ihre Basis bildet unter anderem […]
Die Studiengänge der Höheren Fachschulen können mit dem Niveau der an Fachhochschulen angebotenen Bildungen mithalten. Sie sind auch im internationalen Vergleich konkurrenzfähig. Dies sind Ergebnisse einer Untersuchung des Instituts für Wirtschaftspädagogik St. Gallen (IWP). Die Studie zeigt zudem in vier Szenarien Entwicklungsperspektiven für die Höhere Berufsbildung auf, namentlich in Beziehung zu den Fachhochschulen. Eva Desarzens, Generalsekretärin der Konferenz Höhere Fachschulen (K-HF), nimmt zur Studie und den Szenarien Stellung.
Es gibt viele Lehrbetriebe, die Jugendliche trotz Lernschwierigkeiten oder auffälligem Verhalten ausbilden. Im Rahmen der Studie AgiL wurde untersucht, welche Voraussetzungen betriebliche Bildungsverantwortliche dafür erfüllen müssen. Dazu gehören Aspekte wie realistische Erwartungen an die Auszubildenden, strukturierte Arbeitsabläufe oder eine wohlwollende Beziehungsgestaltung.
Die Zusammenarbeit der drei Lernorte ist eine ständige, anspruchsvolle Aufgabe in der Berufsbildung. Diese Lernortkooperation stand im Zentrum des OKB-Symposiums von Ende 2016. Die Referenten waren sich einig: Noch finden sich nur wenige Beispiele für eine gelungene Lernortkooperation. Josef Widmer, Vizedirektor Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sieht die Verantwortung für eine Verbesserung der Situation in der organisatorische Zuständigkeit der Berufsfachschulen. Dieter Euler erkundete in seinem Referat die Frage, was Lernortkooperation denn erschwere. Eine seiner Thesen: Die Berufsbildung funktioniert auch ohne sie. Wir dokumentieren den Vortrag.
Die Berufsmaturität (BM) hat sich seit der Reform der BM-Verordnung 1993 positiv entwickelt. Etwa jeder siebte Lernende, der eine berufliche Grundbildung absolviert, erwirbt auch einen BM-Abschluss. Dennoch konnten nicht alle mit der Reform verbunden Ziele erreicht werden. So laden die interkantonale Volatilität der BM-Quoten, ihre Einflussfaktoren sowie die Reaktion politischer Akteure auf die Schwankungen zum Diskurs ein. Die Autoren des vorliegenden Beitrags plädieren dafür, anstelle von Image-Kampagnen Fragen zur Organisation der BM zu stellen.